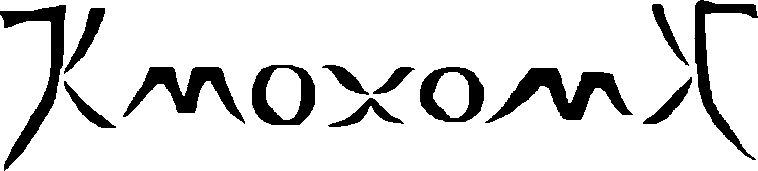4. Unerklärliche Beobachtungen?
6. Erklärung des Unerklärlichen
7. Laborversuche zur Beeinflussung epigenetischer Mechanismen
7. Laborversuche zur Beeinflussung epigenetischer Mechanismen
Mit Hilfe von Laborversuchen versucht man inzwischen den epigenetischen Mechanismen und der Vererbung auf epigenetischem Weg auf die Spur zu kommen.
7.1 Affen mit biblischem Alter – das japanische Paradox im Laborversuch
An der Universität von Wisconsin in Madison wurde im Laufe von 20 Jahren an Rhesusaffen erforscht, wie sich eine kalorienreduzierte Ernährung auf Gesundheit und Alter auswirkte (Colman et al. 2009).
Zu diesem Zweck musste sich die eine Tiergruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe mit um 30% kalorienreduzierter Nahrung zufrieden geben.
Nach Ablauf der 20 Jahre waren nur noch 50% der Tiere der Kontrollgruppe am Leben, während bei den Tieren mit kalorienreduzierter Kost noch 80% lebten.
Außerdem erfreuten sich die Tiere, welche nur kalorienreduzierte Nahrung zu sich nahmen, einer ausgesprochen guten Gesundheit. Typische Alterskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs traten bei ihnen im Vergleich zur Kontrollgruppe mit erheblicher Verzögerung auf.
Die bei Rhesusaffen sonst sehr häufig auftretende Altersdiabetes trat sogar nur noch in der Kontrollgruppe auf, nicht jedoch bei kalorienreduzierter Ernährung.
Die Erklärung für diesen starken Einfluss der Ernährung auf Alter und Gesundheit wurde bereits im Zusammenhang mit dem japanischen Paradox genannt.
Evolutionär war eine Anpassung an Nahrungsmangel von großem Vorteil und der Stoffwechsel wurde daher gut auf diesen Nahrungsmangel eingestellt. Da Nachwuchs während der Schwangerschaft bereits den Stoffwechsel auf die zu erwartende Umgebung einstellt und die Nahrungssituation nur über die Ernährung durch die Mutter gemessen werden kann, wird diese Nahrungsmenge als Umweltbedingung angenommen.
Da das Kind aber noch geboren werden muss und das Muttertier daher nur ein begrenztes Wachstum zulassen kann, wird auch in Zeiten von Überfluss eine Nahrungsknappheit vorgetäuscht. Daher ist der Stoffwechsel der später ausgewachsenen Tiere auf eine geringere Nahrungsversorgung eingestellt und ein lang anhaltender Nahrungsüberfluss führt zu Krankheiten, welche einen früheren Tod zur Folge haben können.
7.2 Ernährung heilt Gendefekt bei Mäusen
Labormäuse gehören meist bestimmten Inzuchtstämmen an, welche gezüchtet werden, indem immer wieder Brüder und Schwestern gepaart werden.
Diese Stämme haben für die Forscher Vorteile, da Mäuse dieser Stämme genetisch fast identisch sind und mutierte Gene und ihre Auswirkungen damit genau untersucht werden können.
Forscher aus Arkansas arbeiteten mit einer dieser Mutanten, welche viable yellow agouti genannt wird, nachdem nachgewiesen wurde, dass die Ernährung die Ausprägung des mutierten Gens beeinflusste (Cooney et al. 2002).
Das sogenannte Agouti-Gen beeinflusst die Fellfarbe der Mäuse. Mäuse ohne dieses Gen besitzen eine schwarze Fellfarbe, durch das Agouti-Gen entwickelt sich unterhalb der Haarspitze ein gelbes Band, welches dem Haar eine graubraune Fellfarbe verleiht, die auch Agouti genannt wird.
Bei der Mutante, bei der das Agouti-Gen zum viable yellow agouti Gen mutiert ist, können nun verschiedene Veränderungen beobachtet werden. Zum einen besitzen Mäuse mit dieser Mutation trotz gleichen Erbguts selbst innerhalb eines Wurfs eine sehr variable Fellfärbung, die von agoutifarbenen Mäusen über gefleckte Mäuse bis hin zu fast gelben Mäusen reicht. Außerdem neigen Mäuse mit dieser Genvariante verstärkt zu Fettleibigkeit, daraus folgend zu Diabetes und sie entwickeln häufig Krebs. Die Färbung des Fells und die Wahrscheinlichkeit zu erkranken, sind dabei gekoppelt und gelbe Mäuse sind am stärksten betroffen.
Dass Mäuse mit identischem Erbgut einen unterschiedlichen Phaenotyp aufweisen, lässt darauf schließen, dass epigenetische Faktoren eine Rolle spielen. Tatsächlich besitzen die für Fettleibigkeit anfälligen gelben Mäuse ein anderes Methylierungsmuster.
In einem bestimmten Bereich ist ein Abschnitt der DNA mit deutlich weniger Methylgruppen ausgestattet als es bei den nicht gelben, gesünderen Mäusen der Fall ist. Es handelt sich bei diesem Bereich um ein Transposon. Bei den kranken Mäusen wird dieses Transposon aktiv und mit ihm ein in ihm versteckter Promotor. Dieser führt dazu, dass das Gen für die Fellfarbe im ganzen Körper aktiv ist und auch dauerhaft aktiv bleibt. Im Normalfall wäre das Gen nur in den für das Fell zuständigen Zellen aktiv und das auch nur während eines kurzen Zeitpunkts in der Entwicklung der Mäuse.
Durch die dauerhafte Aktivität des Gens wird die gelbe Fellfarbe verursacht und es kommt zu den beschriebenen Krankheitssymptomen. Weiterhin kann das Transposon anfangen zu springen und so Schäden im Genom anrichten.
Um den Einfluss der Ernährung auf die Aktivität des Gens genauer zu erforschen, wurden die weiblichen Mäuse anstatt mit dem standardisierten Futter mit einer besonderen Variante desselben gefüttert.
Dabei wurden zwei Futtervarianten genutzt. Die eine war mit Cholin, Betain, Folsäure und Vitamin B12 versetzt, bei der anderen Futtervariante wurden diese Nahrungsergänzungen noch einmal von der Menge her verdreifacht und durch Zink und Methionin ergänzt. Der Grund, weshalb speziell diese Substanzen gewählt wurden, lag daran, dass diese als Lieferanten von Methylgruppen bekannt waren oder sie im Methylstoffwechsel der Zellen eine besondere Rolle spielten.
Zwei Wochen vor der ersten Begattung erhielten die Tiere erstmals das angereicherte Futter und bekamen es weiterhin bis zur Geburt des Nachwuchses.
Das Ergebnis war, dass bei den Mäusen, welche das angereicherte Futter bekamen, mehr normal gefärbte Jungtiere zur Welt kamen als bei Tieren, welche Standardfutter erhielten. Bei den Tieren, welche das Futter mit besonders hohen Dosen an Nahrungsergänzungen bekamen, war die Anzahl an normal gefärbten Tieren sogar noch stärker erhöht, als bei den Tieren, welche weniger stark angereichertes Futter erhielten.
Da Fellfarbe und Krankheitsbild gekoppelt waren, konnte man davon ausgehen, dass die Tiere auch gesund waren.
Mit der Nahrung wurde es den Tieren also anscheinend ermöglicht, das defekte Gen zu inaktivieren.

Abb.10: Mäuse mit Axin(Fu)-Allel aber unterschiedlicher Methylierung
oben: ausgeprägtes Axin(Fu)-Allel (Muttertier wurde normal ernährt)
unten: nicht ausgeprägtes Axin(Fu)-Allel (Muttertier erhielt Nahrung mit Methylgruppenlieferanten)
Foto: Photograph courtesy of Emma Whitelaw, University of Sydney, Australia.
Lizenz: Creative Commons Attribution 2.5 Generic
Die Originaldatei ist hier zu finden.
Die Muttertiere profitierten zwar nicht von der Behandlung mit dem Futter, jedoch konnte dem Nachwuchs ein besserer Start ins Leben ermöglicht werden.
Ein australisches Forscherteam bemühte sich einige Zeit später das Experiment nachzustellen, um auf dessen Basis weitere Experimente zu machen, hatte jedoch unerwartet mit Problemen zu kämpfen. Trotz einer großzügigen Versorgung der Mäusemütter mit Nahrung, welche sie mit ausreichend Methylgruppen versorgte, zeigte sich beim Nachwuchs keine Wirkung und die Farbverteilung änderte sich nicht (Cropley et al. 2006).
Beim Versuch, die Ursache zu finden, stellte sich schließlich heraus, dass die amerikanischen Tiere das viable yellow agouti Gen von den Vätern vererbt bekamen, während die australischen Tiere das Gen von ihren Müttern geerbt hatten.
Als die Australier den Versuch noch einmal wiederholten, diesmal mit Tieren, welche das Gen vom Vater geerbt hatten, stellten sie tatsächlich die Verschiebung der Farbverteilung fest, welche die Amerikaner beschrieben hatten. Es hing also auch von der Herkunft der Genvariante ab, ob diese durch Methylgruppenlieferanten stillgelegt werden konnte.
Mit den gewonnenen Erkenntnissen machten sich die Australier nun daran, ein weiteres Experiment zu starten, bei dem sie erfahren wollten, ob auch die Vorläufer der Eizellen, welche bereits im Embryonalstadium entstehen, durch die andere Ernährung beeinflusst werden und somit eine Vererbung auf die Generation der Enkel stattfindet.
Hierzu bekamen die Weibchen nur vom achten bis fünfzehnten Tag der Schwangerschaft das angereicherte Futter.
Unter den Nachkommen wählte man dann graubraune Weibchen aus, welche man mit männlichen Tieren verpaarte, die die Genvariante nicht besaßen.
Das Ergebnis war, dass doppelt so viele gesunde Tiere zur Welt kamen wie in der Kontrollgruppe. Damit war bestätigt, dass die Ernährung auch die im Embryonalstadium entstehenden Vorläufer der Eizellen beeinflusste und damit die Ernährung der Großmütter während der Schwangerschaft einen direkten Einfluss auf die Enkel hatte.
Dass dieser Einfluss der Ernährung auf Gendefekte kein Einzelfall ist, zeigt das Beispiel von Mäusen mit dem sogenannten Axin(Fu)-Allel (Waterland et al. 2006). Bei Mäusen mit diesem Allel ist in der Embronalentwicklung die Ausbildung der Körperachse gestört, weshalb die Tiere häufig mit geknickten Schwänzen zur Welt kommen. Fügt man der Nahrung nun Methylgruppenspender hinzu, so kommen wesentlich mehr der Mäuse mit geradem Schwanz zur Welt.
7.3 Vererbung von Erfahrungen bei Ratten
Neben der Ernährung gibt es noch viele weitere Umwelteinflüsse, welche sich lange Zeit auswirken und auch an nachfolgende Generationen vererbt werden können.
Einer dieser Umwelteinflüsse ist die mütterliche Fürsorge.
Untersucht wurde dieser Einfluss an Rattenbabys, da schon lange bekannt war, dass die Stimulation von Rattenbabys bei ihnen zu einer veränderten Stressreaktion im Erwachsenenalter führt (Liu et al. 1997).
Zu diesem Zweck wurden während der ersten 21 Tage des Lebens der Rattenbabys die Mütter einmal pro Tag von ihrem Nachwuchs getrennt und dieser in eine kleine Schachtel gelegt. Nach 15 Minuten brachte man die Babys wieder zu ihren Müttern zurück.
In Anbetracht der Tatsache, dass Rattenmütter mehrmals täglich ihr Nest verlassen und ihren Nachwuchs dort allein zurück lassen, sollten diese 15 Minuten kaum ins Gewicht fallen. Tatsächlich konnte jedoch beobachtet werden, dass gerade diese Tiere sich im späteren Leben als wesentlich stressresistenter und mutiger erwiesen als Tiere, die nicht von den Eltern getrennt worden waren.
Man vermutete nun, dass nicht die Trennung ausschlaggebend war, sondern ein durch die Trennung induziertes verändertes mütterliches Verhalten. Als man deshalb die Interaktionen zwischen Müttern und Kindern verglich, fiel auf, dass die durch Menschenhand gegangenen Jungtiere von ihren Müttern wesentlich ausgiebiger gepflegt und gereinigt wurden als Jungtiere, die nicht von ihren Müttern getrennt wurden.
Die Trennung schien bei den Babyratten ein stärkeres Schreien zu verursachen, auf welches die Muttertiere mit intensiverer Pflege reagierten.
Eine intensivere mütterliche Fürsorge in den ersten Lebenswochen führte also zu stressresistenteren und mutigeren Erwachsenen.
Um dies zu bestätigen, beobachtete man die Unterschiede im Pflegeverhalten von Rattenmüttern, ohne die Kinder aus dem Nest zu nehmen. Tatsächlich gab es große Unterschiede im Pflegeverhalten der Rattenmütter. Das Spektrum ging von liebevollen Müttern bis hin zu Müttern, die ihren Nachwuchs weitgehend ignorierten.
Als man die Entwicklung der Jungtiere beobachtete, stellte man fest, dass die Babys, welche von den Müttern weitgehend ignoriert wurden, im Erwachsenenalter geradezu verängstigt waren und immer in die hintersten Ecken der Käfige flohen.
Die Fürsorge der Mütter hatte also tatsächlich einen entsprechenden Einfluss.
1999 berichteten kanadische Wissenschaftler außerdem, dass die weiblichen Nachkommen intensiv pflegender Mütter sich später genauso intensiv dem eigenen Nachwuchs widmeten, während weibliche Nachkommen von Rattenmüttern, welche ihren Nachwuchs weitgehend ignorierten, den eigenen Nachwuchs später ebenso vernachlässigten (Francis et al. 1999).
Um zu bestätigen, dass dieses Phänomen tatsächlich mit der Behandlung durch die Eltern zusammen hängt, tauschte man die Babyratten zwischen den Müttern aus. Tatsächlich war es egal, von welchem Tier die Rattenbabys abstammten. Wer eine fürsorgliche Pflegemutter erhielt, erwies sich später selbst als gutes Muttertier, während Babyratten, die eine schlechte Pflegemutter erhielten, später ebenso nachlässige Mütter wurden.
Damit wird ein kurz nach der Geburt durch Erfahrungen erworbenes Verhalten auch in folgende Generationen vererbt, allerdings findet diese Vererbung durch ein verändertes Verhalten statt.
Handelt es sich dabei aber tatsächlich um einen Effekt der Epigenetik?
Erinnern wir uns an die Definition von Epigenetik:
„Studium der erblichen Veränderungen in der Genfunktion, die ohne eine Änderung der DNA-Sequenz auftreten“
Es muss sich also um eine Veränderung der Genfunktion handeln.
Zunächst würde man vermuten, dass dieser Effekt psychologische Ursachen hat und die Psychologie als eigenständigen Bereich sehen. Bedenkt man jedoch die hormonellen Grundlagen der Psychologie, so ist eine Veränderung der Genfunktion als Ursache durchaus denkbar.
Natürlich versuchte man den Mechanismus für die Beobachtungen an den Ratten heraus zu finden und wieder einmal fand man die Antwort in Form von Methylgruppen.
In der Promotorsequenz eines Gens, welches vor allem im Hippocampus aktiv ist, waren bei den vernachlässigten Tieren alle 17 Cytosin-Guanin-Sequenzen methyliert, während bei den gut umsorgten Tieren viele der Cytosin-Guanin-Sequenzen unmethyliert blieben.
Das Gen, welches zu diesem Promotor gehört, kodiert für einen Glukocorticoid-Rezeptor, welcher die Stressantwort abschwächt.
Bei den vernachlässigten Tieren ist durch die Methylierung das Gen für diesen Rezeptor stark gehemmt und es werden nur wenige dieser Rezeptoren produziert. Somit kommt es zu einer Stressantwort in voller Stärke. Bei den gut umsorgten Tieren dagegen ist das Gen aktiv und der Rezeptor kann die Reaktion auf den Hormoncocktail abschwächen.
Damit handelt es sich also tatsächlich um eine Veränderung der Genfunktion und damit um eine epigenetische Vererbung auf Basis von unterschiedlichem Verhalten.
Nun bleiben die Fragen offen, ob sich diese Beobachtungen auf den Menschen übertragen lassen und was der evolutionäre Sinn einer solchen Vererbung ist?
Für die Übertragbarkeit der Beobachtungen auf den Menschen finden sich Anhaltspunkte. Ein extremes Beispiel hierfür kann bei Opfern von Kindesmisshandlung beobachtet werden.
Statistisch lässt sich nachweisen, dass gerade diese Opfer später selber zu den Tätern der nächsten Generation werden.
Im Fall von Kindesmisshandlung handelt es sich allerdings um ein komplexes Phänomen, bei dem viele soziale Faktoren aus dem Umfeld ebenso eine Rolle spielen.
Die Frage nach dem evolutionären Sinn im Zusammenhang mit Kindesmisshandlungen verbietet sich aus verständlichen moralischen Gründen.
Bei den Ratten ist diese Frage dagegen durchaus gerechtfertigt.
Aus Sicht eines Rattenbabys ist seine Mutter so ziemlich das einzige Bindeglied zur Außenwelt. Wenn die Außenwelt nun die Verfassung der Mutter beeinflusst, so bekommen sie das durch das Pflegeverhalten des Muttertiers mit. Beispiele hierfür wären eine gefährliche Umwelt, der Rang im sozialen Umfeld oder Nahrungsmangel.
Die Kinder können somit am Pflegeverhalten des Muttertieres die Situation in ihrer Umgebung abschätzen. Ist das Muttertier gestresst und zeigt deshalb ein schlechteres Fürsorgeverhalten, so lässt dies auf eine gefährliche Umwelt schließen. Die Rattenbabys solcher Mütter sind daher Übervorsichtig, da dies einen Überlebensvorteil darstellt.
Ist das Muttertier dagegen nicht gestresst und findet Zeit und Kraft, sich fürsorglich um die Kinder zu kümmern, so ist die Umwelt vermutlich ungefährlich. Die Rattenbabys solcher Mütter sind mutig und stressresistent, was bei ungefährlichen Lebensbedingungen ebenso einen Vorteil darstellt, da sie aufgrund ihres Mutes besser dazu in der Lage sind, zum Beispiel neue Lebensräume zu erobern.
Da die Nachkommen in der Regel die selben Umweltbedingungen vorfinden wie ihre Mütter, ist es auch evolutionär von Vorteil, diese Anpassung an die Umweltbedingungen an die Kinder weiter zu geben.
7.4 Chaperone, Epigenetik und Evolution
Chaperone sind Proteine, die anderen Proteinen dabei helfen, sich in der richtigen Weise in ihre dreidimensionale Struktur zu falten. Das ist zum einen direkt nach der Produktion des Proteins notwendig und zum anderen, wenn Proteine aufgrund zu hoher Temperatur denaturieren. Aus diesem Grund werden nach einem Hitzeschock Chaperone vermehrt von der Zelle produziert.
Wissenschaftler an der Universität von Chicago arbeiteten mit einer Mutante von Drosophila, bei der eines dieser Chaperone namens Hsp90 mutiert war (Rutherford 1998):
Hsp90 hilft vor allem bei der Faltung von Signalproteinen. Da diese auch am Zellzyklus und an der Entwicklung eines Organismus mitwirken, ist das Chaperon Hsp90 von essentieller Bedeutung. Sind beide Kopien dieses Chaperons mutiert, kann der Organismus nicht überleben. Aus diesem Grund können mutierte Allele nur in mischerbigen Drosophila-Stämmen, bei denen eine Kopie intakt ist, erhalten werden.
Als man Zuchtstämme dieser Mutante untersuchte, stellte man fest, dass viele der Tiere anatomische Veränderungen aufwiesen. Je nach Zuchtstamm waren diese Veränderungen an verschiedenen Körperteilen zu finden.
Durch Untersuchungen stellte man fest, dass die Variation des Phaenotyps durch eine genetische Vielfalt zu Stande kam, die bereits vorher existierte, sich aber bei gesunden Tieren nicht ausprägte. Erst das mutierte Hsp90-Gen führte dazu, dass es zu einem Mangel an Hsp90 in den Zellen kam und sich dadurch mögliche Merkmale ausprägen konnten, die normalerweise nicht entstanden.
Die Forscher kreuzten die deformierten Tiere im gleichen Stamm untereinander und stellten fest, dass sich die Anzahl an deformierten Tieren immer weiter erhöhte.
Zunächst wurden die Tiere nur danach ausgewählt, ob sie die zu ihrem Stamm gehörenden anatomischen Auffälligkeiten besaßen oder nicht. Aus diesem Grund wussten die Forscher natürlich nicht, ob die Tiere eine Kopie des mutierten Gens enthielten, oder ob beide Allele des Gens intakt waren.
In den Generationen 16-20 wurden die Tiere dann einer Genanalyse unterzogen und man stellte fest, dass die Tiere die anatomischen Auffälligkeiten besaßen, egal ob sie Träger des mutierten Gens waren oder nicht. Demnach waren die Merkmale unabhängig von dem mutierten Hsp90-Gen fixiert worden, welches ursprünglich der Auslöser für den veränderten Phaenotyp war.
Durch das Chaperon Hsp90 schienen sich im Laufe der Zeit Mutationen anhäufen zu können, ohne dass sie als Merkmal ausgeprägt wurden. Die Faltungshilfe durch Hsp90 korrigierte die durch Aminosäuresequenzfehler verursachte Fehlfaltung und erhielt somit die Proteinfunktion trotz der Existenz von Mutationen.
Diese Mutationen sind natürlich, da sie nicht im Phaenotyp ausgeprägt werden, nicht der Selektion unterworfen.
Auch bei Tieren, bei denen beide Kopien des Gens intakt sind, können diese Mutationen unter gewissen Umständen im Phaenotyp auftreten. Kommt es zum Beispiel zu besonders starken Stresssituationen, in denen Umweltstressoren die Faltung der Proteine beeinflussen, so benötigen besonders viele Proteine die Faltungshilfe von Hsp90 und es kommt auch hier zu einem Mangel an Hsp90.
Die meisten dieser Varianten wären vermutlich zum Nachteil der Tiere und sie würden in der Natur durch die Selektion aussortiert werden. Einige der Varianten könnten jedoch auch Vorteile gegenüber der ursprünglichen Form haben und besser überleben. Würden die Umweltbedingungen lange genug zu einem Mangel an Hsp90 führen, so könnten sich die Merkmale auf diese Weise in der Spezies fixieren.
Mit diesem Mechanismus ließen sich plötzlich auftretende Entwicklungsschübe in der Evolution erklären, welche bei Fossilien immer wieder zu Verwirrung geführt haben. Vor diesen Entwicklungsschüben kam es im Laufe der Evolution meist zu einem Massenaussterben, welches auch ein Indiz für Umweltstress ist und damit den idealen Nährboden für diesen Mechanismus liefern würde.
2003 stießen amerikanische Wissenschaftler auf ein epigenetisches Phänomen, welches die Effektivität dieses Mechanismus noch verstärkte (Sollars et al. 2003). Die Wissenschaftler wiesen nach, dass eine durch Umweltstress verursachte reduzierte Aktivität von Hsp90 zusätzlich zur Ausprägung verborgener Varianten auch zu einer Veränderung der Chromatinstruktur führt.
Diese Veränderung führt genauso wie die geringere Aktivität von Hsp90 zur Ausprägung der verborgenen Varianten.
Außerdem konnte die Veränderung der Chromatinstruktur über mehrere Generationen vererbt werden, wodurch die Merkmale zunächst epigenetisch fixiert wurden.
Damit könnten durch einen einmaligen starken Umweltstress Merkmale zunächst epigenetisch fixiert werden und auch nach Abklingen des Stressors fixiert bleiben, um im Anschluss durch die Selektion genetisch fixiert werden zu können.
Der Umweltstress, der nötig wäre, um einen Entwicklungsschub auslösen zu können und zu einer Fixierung der neuen Varianten führen würde, müsste damit wesentlich kürzer ausfallen, als es ohne Epigenetik der Fall wäre.
vorherige Seite – Gliederung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – nächste Seite